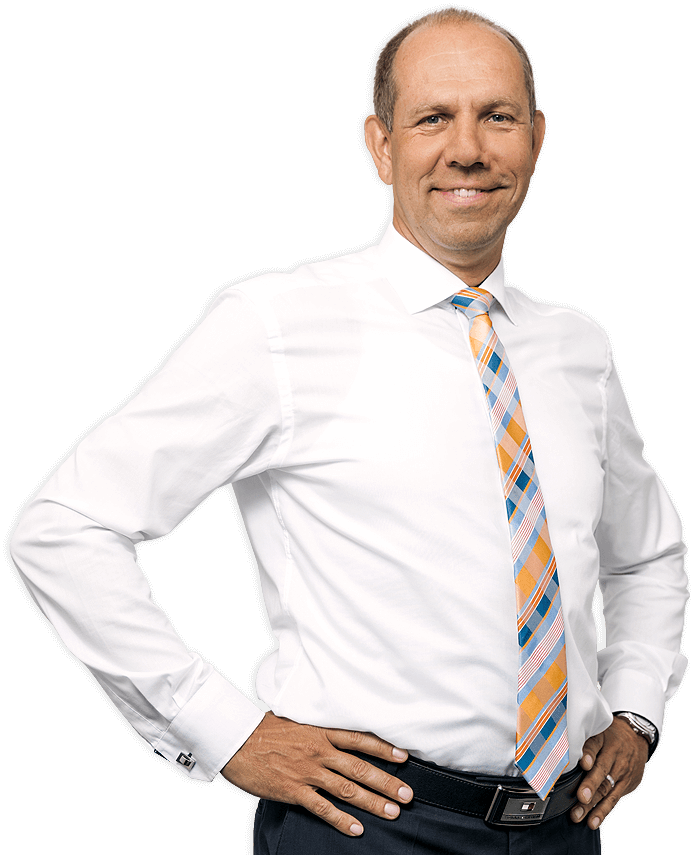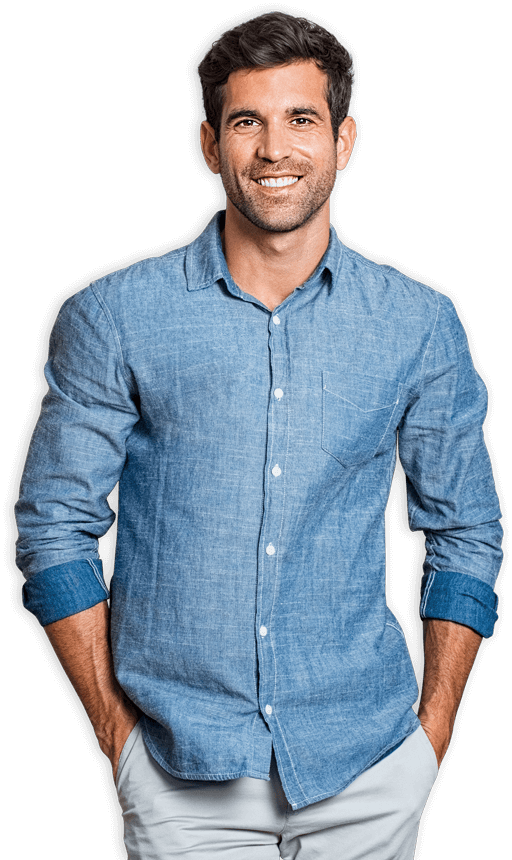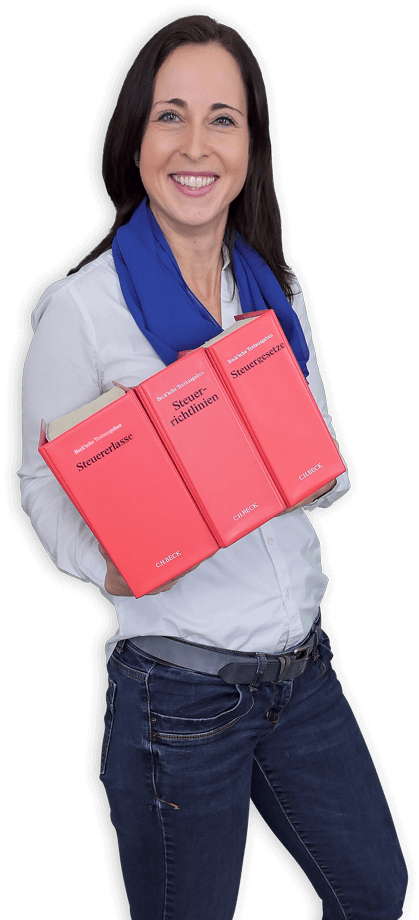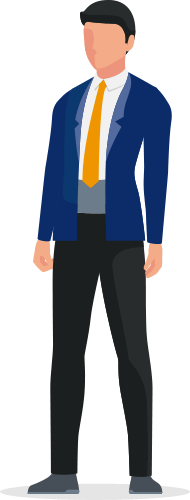Willkommen bei Kalthoff & Kollegen

Theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen verbinden
Katharina Schmehl zählt zu unseren Nachwuchstalenten und absolviert ein ausbildungsintegriertes duales Studium. Heute verrät sie, weshalb sie sich für diesen Ausbildungsweg entschieden hat und was ihr an der Arbeit...

Unsere Kanzlei wächst – und bleibt sich treu
Wir freuen uns sehr, Ihnen eine wunderbare Entwicklung in unserer Kanzlei bekanntzugeben: Seit dem 01. Januar 2025 gehört Steuerberaterin Nadine Will offiziell zur Partnerschaft von Kalthoff & Kollegen...

Kalthoff & Kollegen spenden 50 Trösteteddys an das DRK in Rheinberg
Eine Verletzung, Schmerzen, ein Rettungswagen mit Blaulicht und unbekannte Erwachsene: Bei diesem Szenario können es Kinder es schnell mit der Angst zu tun bekommen. Gut, wenn dann...

Kalthoff & Kollegen zum achten Mal in Folge Top Steuerberater
Wir freuen uns sehr erneut von unserer erfolgreichen Teilnahme am deutschlandweiten Focus-Money-Steuerberatertest 2025 berichten zu dürfen. Im Rahmen einer empirischen Erhebung...

Digitale DATEV-Kanzlei 2021
Mit dem Label „Digitale DATEV-Kanzlei“ werden innovative Kanzleien ausgezeichnet, die einen hohen Digitalisierungsgrad in Ihrer Arbeitsweise erreicht haben. Die Kanzlei muss sich jedes Jahr die Voraussetzungen für den Erhalt dieser Auszeichnung...

KuK:App - Die Mandanten-APP von Kalthoff & Kollegen
Ihr Steuerberater in der Hosentasche! Geht nicht? Doch, geht mit unserer App für Ihr Tablet oder Handy. Ganz gleich ob IOS oder Android, die Bedienung geht einfach von der Hand. Wir haben...
Was wir machen

Mittelstandsdigitalisierung

Steuerberatung

Unternehmensberatung

Rechtsberatung

Branchen

Karriere
Spezialthemen

Auszubildende im Betrieb: Ein großer Leitfaden für Arbeitgeber
Fachkräfte fehlen an vielen Stellen. Viele erfahrene Mitarbeiter gehen bald in Rente. Deshalb ist die eigene Ausbildung von Nachwuchs heute wichtiger als je zuvor. Aber was müssen Sie rechtlich beachten? Hier finden Sie alle Regeln zu Verträgen, Pflichten und Finanzen einfach erklärt...

Einfachere Umsatzsteuer im Online-Handel: Der One-Stop-Shop (OSS)
Wer Waren oder Dienstleistungen an Privatkunden im EU-Ausland verkauft, stand lange vor einem bürokratischen Berg: Registrierungen in jedem einzelnen Lieferland waren oft Pflicht. Seit Juli 2021 erleichtert der sogenannte „One-Stop-Shop“ (OSS) diese Prozesse erheblich. Doch wie funktioniert das Verfahren genau und für wen...

Datenzugriff der Finanzverwaltung
Das Finanzamt darf bei Prüfungen Einblick in Ihre digitalen Geschäftsunterlagen nehmen. Gemeint sind vor allem die Daten aus der Finanzbuchhaltung, der Lohnbuchhaltung, der Anlagenbuchhaltung sowie aus elektronischen Kassensystemen. Auch Vor- und Nebensysteme (zum Beispiel Warenwirtschaft) können dazugehören, wenn dort Geschäftsvorfälle...

Finanzspritze vom Chef: Steuerlicher Umgang mit Arbeitgeberdarlehen
Von der Erfüllung eines lang gehegten Wunsches über das Tätigen einer zukunftsträchtigen Investition bis hin zur Bewältigung einer finanziellen Notsituation: Viele Vorhaben lassen sich nur umsetzen, wenn ausreichende Geldreserven vorhanden sind. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, besteht allerdings noch die Möglichkeit, sich die fehlenden Moneten zu leihen. Sollten darlehensbeantragende...
Aktuelles aus Recht und Wirtschaft
24.02.26 | Abschiedsfeier für Mitarbeiter kein Arbeitslohn
Unternehmen können die Kosten für die Verabschiedung ihrer Mitarbeiter in den Ruhestand ohne lohnsteuerliche Nachteile übernehmen. Voraussetzung ist, dass die Veranstaltung als betriebliche Feierlichkeit ausgestaltet ist. Dies stellt ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) klar.
Eine Bank veranstaltete in ihren Geschäftsräumen einen Empfang, um den scheidenden Vorstandsvorsitzenden zu verabschieden und gleichzeitig seinen Nachfolger vorzustellen. Organisation und Umsetzung oblagen der Personalabteilung. Die Gästeliste wurde unabhängig von der konkreten Veranstaltung nach geschäftsbezogenen Gesichtspunkten festgelegt. Unter den circa 300 geladenen Gästen befanden sich frühere und jetzige Vorstandsmitglieder, ausgewählte Mitarbeitende sowie Angehörige des öffentlichen Lebens aus Politik und Wirtschaft. Außerdem waren acht Familienangehörige des scheidenden Vorstandsvorsitzenden eingeladen.
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Kosten dem ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden als Arbeitslohn zuzurechnen seien und nahm die Bank für die hierauf entfallende Lohnsteuer in Haftung. Das Niedersächsische Finanzgericht sah dies anders. Es gab der Klage teilweise statt und bejahte steuerpflichtigen Arbeitslohn insoweit, als die Kosten auf den ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden und seine Familienangehörigen entfallen sind.
Veranstaltung mit ganz überwiegend beruflichem Charakter
Der BFH hat die Revision des Finanzamts mit Urteil vom 19.11.2025 (Az. VI R 18/24) zurückgewiesen. Die Verabschiedung habe ganz überwiegend beruflichen Charakter, so der BFH. Sie stelle den letzten Akt im aktiven Dienst des Arbeitnehmers dar und sei damit noch Teil der Berufstätigkeit. Mit der Verabschiedung ging zudem die Amtseinführung des Nachfolgers einher. Die Bank selbst trat als Gastgeberin in ihren Räumen, bestimmte die Gästeliste und trug die Kosten.
Teilnahme der Familienangehörigen gesellschaftsüblich
Der BFH hat zudem geklärt, dass entgegen der Auffassung des Finanzgerichts auch die auf den Vorstandsvorsitzenden selbst und seine Familienangehörigen entfallenden Kosten kein Arbeitslohn sind, wenn wie im Streitfall die Teilnahme der Familienangehörigen gesellschaftsüblich ist.
Das Urteil stellt damit klar, dass Unternehmen die Kosten für die Verabschiedung ihrer scheidenden Mitarbeiter ohne lohnsteuerliche Nachteile übernehmen können, solange die Veranstaltung als betriebliche Feierlichkeit ausgestaltet ist.
(BFH / STB Web)
Artikel vom: 24.02.2026
24.02.26 | Stimmung unter Startups durchwachsen
Deutschlands Startups sind beim Blick auf die Lage des eigenen Unternehmens gespalten: Rund ein Drittel (35 Prozent) berichtet von einer Verbesserung im vergangenen Jahr, fast ebenso viele (30 Prozent) aber von einer Verschlechterung. Für?weitere 35 Prozent?ist die Lage unverändert.
Das ist das Ergebnis einer Befragung unter?133 Tech-Startups in Deutschland im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Deutlich skeptischer fällt der Blick auf die allgemeine Lage deutscher Startups aus: Nur 19 Prozent haben im vergangenen Jahr eine Verbesserung gesehen, 37 Prozent hingegen eine Verschlechterung. Rund jedes elfte Startup (9 Prozent) befürchtet im Laufe der kommenden zwölf Monate eine Insolvenz.
"Viele Startups kommen voran, aber ebenso viele kämpfen mit der schwierigen konjunkturellen Lage. Was allen helfen würde: leichterer Zugang zu öffentlichen Aufträgen, weniger Regulierung und mehr Möglichkeiten, Daten für innovative Services und Technologien einzusetzen", sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst.
Aktuell würde nur die Hälfte der Gründenden (50 Prozent) wieder in Deutschland gründen. 20 Prozent würden sich für ein anderes EU-Land entscheiden, nur 7 Prozent für die USA und 11 Prozent für ein anderes Land der Welt. 8 Prozent wollen oder können dazu keine Angabe machen – und 5 Prozent würden überhaupt nicht erneut gründen.
(Bitkom / STB Web)
Artikel vom: 24.02.2026
24.02.26 | Anteil ausländischer Ärztinnen und Ärzte gestiegen
In Deutschland arbeiten immer mehr ausländische Ärztinnen und Ärzte. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, hatten im Jahr 2024 13 Prozent oder rund 64.000 Ärztinnen und Ärzte keine deutsche Staatsangehörigkeit. Zehn Jahre zuvor waren es noch 7 Prozent (30.000).
Insgesamt arbeiteten 2024 in der Human- und Zahnmedizin 121.000 aus dem Ausland zugewanderte Ärztinnen und Ärzte, das war knapp ein Viertel (24 Prozent) der gesamten Ärzteschaft. Ein Teil von ihnen besitzt inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft.
Anerkennung ausländischer Abschlüsse
Neben dem Medizinstudium und der Approbation hierzulande können auch im Ausland erworbene Abschlüsse mit voller Gleichwertigkeit anerkannt werden. 2024 waren Ärztinnen und Ärzte nach Pflegefachkräften die Berufsgruppe mit den zweitmeisten Anerkennungen ausländischer Abschlüsse. Rund 7.000 Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem Abschluss erhielten die Anerkennung mit voller Gleichwertigkeit in Deutschland. Darunter waren 21 Prozent oder gut 1.400 Deutsche, gefolgt von 11 Prozent oder knapp 800 Syrerinnen und Syrern.
Zahnärztinnen und Zahnärzte lagen auf Rang 7 der Berufe mit den meisten Anerkennungen ausländischer Abschlüsse. 2024 wurden in der Zahnmedizin knapp 700 ausländische Abschlüsse als voll gleichwertig anerkannt. Die meisten Anerkennungen erhielten auch hier deutsche Zahnärztinnen und Zahnärzte (46 Prozent oder rund 300), gefolgt von syrischen (12 Prozent oder rund 100).
Viele wählen Studium im Ausland
Die Daten über die Anerkennung ausländischer Abschlüsse zeigen, dass viele Medizinstudierende aus Deutschland den Weg über ein Studium im Ausland wählen. Der Grund dafür sind häufig die Zulassungsbeschränkungen des Studienfachs in Deutschland, so das Statistische Bundesamt.
(Destatis / STB Web)
Artikel vom: 24.02.2026
23.02.26 | Deutliche regionale Unterschiede beim Gender Pay Gap
Im bundesweiten Durchschnitt erhielten vollzeitbeschäftigte Frauen im Jahr 2024 17,2 Prozent weniger Lohn oder Gehalt als vollzeitbeschäftigte Männer. Der Gender Pay Gap sinkt zwar insgesamt, jedoch nicht in allen Regionen, wie eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt.
Zwischen 2019 und 2024 ist der Gender Pay Gap deutschlandweit um 3,2 Prozentpunkte zurückgegangen. Der Rückgang zeigt sich allerdings nicht in allen Regionen Deutschlands – in 15 von 400 Kreisen ist der unbereinigte Gender Pay Gap der Studie zufolge sogar gestiegen.
In Westdeutschland bleibt der Gender Pay Gap mit 18,9 Prozent knapp viermal so hoch wie in Ostdeutschland mit 5,1 Prozent. Dabei fiel der Rückgang in Westdeutschland mit 3,3 Prozentpunkten stärker aus als in Ostdeutschland mit 2,0 Prozentpunkten. Mecklenburg-Vorpommern weist den niedrigsten Gender Pay Gap auf. Hier verdienen Frauen im Durchschnitt 2,4 Prozent weniger als Männer. In Baden-Württemberg hingegen beträgt die Lohnlücke 25,7 Prozent.
Auf Kreisebene ist die Spannweite des Gender Pay Gaps oft noch größer als zwischen den Bundesländern. Dies hänge unter anderem mit regional unterschiedlichen Veränderungen der Betriebsgrößen- und Berufsstruktur zusammen, so das IAB.
(IAB / STB Web)
Artikel vom: 23.02.2026
19.02.26 | Steuerliche Anerkennung von arbeitnehmerfinanzierten Pensionszusagen
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung arbeitnehmerfinanzierter Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH konkretisiert. Neben Erleichterungen hat er auch die Grenzen aufgezeigt.
Wird die zugesagte Pension ausschließlich durch Gehaltsumwandlung finanziert, ist die Zusage auch dann fremdüblich und grundsätzlich steuerlich anzuerkennen, wenn sie ohne Einhaltung einer Probezeit und unmittelbar oder kurze Zeit nach Neugründung der Gesellschaft erteilt worden ist.
Voraussetzung für diese Erleichterungen ist aber stets, dass für den Arbeitgeber, also für die Gesellschaft, kein signifikantes Risiko besteht, die künftigen Versorgungsansprüche des Geschäftsführers mitfinanzieren zu müssen.
Im Streitfall hatte die Gesellschaft ihrem alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführer eine Pensionszusage in Form einer Direktzusage erteilt. Die Versorgungsbeiträge leistete dieser im Wege einer monatlichen Gehaltsumwandlung; die Gesellschaft bildete hierfür Pensionsrückstellungen. Das Finanzamt erkannte diese jedoch nicht an, weil die Pensionszusage dem Gesellschafter-Geschäftsführer nach seinem 60. Geburtstag gewährt worden sei und er sie sich deshalb nicht habe "erdienen" können. Deshalb behandelte das Finanzamt die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen als verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA).
Zurückweisung an das Finanzgericht
Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht hatte zwar Erfolg. Der BFH hob diese Entscheidung mit Urteil vom 19.11.2025 (Az. I R 50/22) jedoch auf und verwies die Sache zurück an das Finanzgericht. Eine vGA sei zwar grundsätzlich auszuschließen, wenn die Zusage durch Gehaltsumwandlung vom Arbeitnehmer finanziert werde und das Unternehmen nicht mit Risiko- und Kostensteigerungen belaste.
Unter diesen Voraussetzungen komme es auch nicht auf die Einhaltung einer Probezeit, den Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft oder die altersabhängige Erdienbarkeit der Pension an.
Anspruch muss insolvenzgesichert sein
Dennoch reichten die bisherigen Feststellungen des Finanzgerichts für den BFH nicht aus. Unter anderem sei eine wie im Streitfall vereinbarte Direktzusage regelmäßig nicht ernstlich vereinbart – und damit steuerlich nicht anzuerkennen – wenn der Anspruch auf die künftigen Versorgungsleistungen nicht insolvenzgesichert sei.
Keine Mitfinanzierung durch den Arbeitgeber
Da die Pensionszusage in zeitlicher Nähe zur erstmaligen Gehaltsgewährung vereinbart worden war, muss das Finanzgericht darüber hinaus prüfen, ob tatsächlich eine ausschließlich vom Arbeitnehmer finanzierte Zusage oder bei wirtschaftlicher Betrachtung unter Berücksichtigung einer angemessenen Gesamtausstattung des Gesellschafter-Geschäftsführers eine vom Arbeitgeber (mit)finanzierte Zusage vorliegt.
(BFH / STB Web)
Artikel vom: 19.02.2026
Social Media News
Unsere neuesten Video-Tipps
Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie
Änderung der Steuersätze in der Gastronomie bedeutet Umstellung für die Betriebe.
In diesem Video erfahren Sie in wenigen Minuten, worauf Sie achten müssen.
Was kostet ein Steuerberater – die StbVV
Die Steuerberatervergütungsverordnung, kurz die StbVV, regelt die Vergütung von Steuerberatern in Deutschland.
Wie das Honorar eines Steuerberaters zustande kommt, erfahren Sie in diesem Video.
Workation – Arbeiten im Ausland
Urlaub und Arbeit verbinden – das ist Workation.
Worauf Sie bei Besteuerung und Sozialversicherung achten müssen, erfahren Sie in diesem Video.
Grundsteuerbescheid: Wie Sie Fehler finden und was Sie jetzt dagegen tun können
Ein Grundsteuerbescheid ist in der Regel korrekt, auch wenn die Kosten ab 2025 deutlich gestiegen sind. In manchen Fällen kann er aber angefochten werden.
Wie Sie mögliche Fehler entdecken und was Sie dagegen unternehmen können, erläutert dieses Video.
Schreiben Sie uns