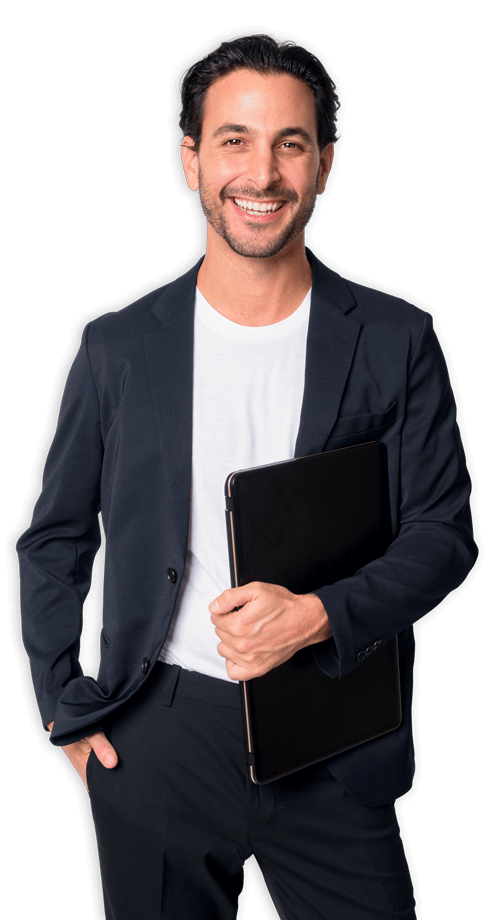22.11.25 | Geschäftsführer scheitert mit Klage: Skiausflug war keine Dienstreise
Ein Geschäftsführer nahm an einer von einem anderen Unternehmen organisierten Skitour teil. Bei einer Abfahrt erlitt er einen Unfall. Das Sozialgericht Hannover hat seine Klage, mit der er die Anerkennung als Arbeitsunfall in der gesetzlichen Unfallversicherung begehrte, jedoch abgewiesen.
Das Programm versprach ein paar erholsame Tage. Die an den Vormittagen geplanten Fachvorträge fielen komplett aus; die Teilnehmenden verbrachten die Zeit daraufhin eigenständig auf der Piste. Während einer Abfahrt kam es zu dem Unfall des Klägers.
Die Unfallversicherung lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Bei der Reise hätten die Freizeitaktivitäten im Vordergrund gestanden. Ein betrieblicher Zusammenhang zur Geschäftsführer-Tätigkeit des Klägers sei nicht erkennbar. Der Kläger argumentierte, die Reise habe dem Aufbau von Geschäftsbeziehungen und dem beruflichen Austausch gedient.
Keine berufliche Arbeit auf der Piste
Dem folgte das Sozialgericht Hannover jedoch nicht. Versicherungsschutz bestehe nur, wenn die im Unfallzeitpunkt verrichtete Tätigkeit in einem inneren, sachlichen Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehe. Ein erwarteter oder mittelbarer Nutzen für das Unternehmen stelle diesen Zusammenhang nicht her.
Geschäftsbeziehungen hätten unabhängig vom Skifahren in Arbeitssitzungen intensiviert werden können. Im Unfallzeitpunkt auf der Piste habe der Kläger keine arbeitsbezogene Pflicht erfüllt.
Der Gerichtsbescheid vom 14.11.2025 (Az. S 22 U 203/23) ist allerdings noch nicht rechtskräftig.
(SG Hannover / STB Web)
Artikel vom: 22.11.2025
18.11.25 | Gesetzlicher Mindestlohn: Firmenwagen erfüllt Anspruch nicht
Sachleistungen wie ein Firmenwagen können den gesetzlichen Mindestlohn nicht ersetzen. Arbeitgeber müssen den Mindestlohn als Geldbetrag zahlen – einschließlich der darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge. Bereits gezahlte Beiträge auf die Firmenwagennutzung genügen dafür nicht.
Das hat das Bundessozialgericht (BSG) am 13. November 2025 in zwei Verfahren entschieden (Az. B 12 BA 8/24 R und B 12 BA 6/23 R). In beiden Fällen hatten Arbeitgeber ihren teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern als einzige Vergütung einen Firmenwagen überlassen und darauf Sozialversicherungsbeiträge abgeführt.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund forderte nach Betriebsprüfungen zusätzliche Beiträge, weil der Mindestlohn nicht gezahlt worden war. Das BSG bestätigte diese Sicht: Der Mindestlohn müsse in Geld gewährt werden; die Überlassung eines Firmenwagens genüge dafür nicht. Es müssen deshalb zusätzlich Beiträge auf den gesetzlichen Mindestlohn abgeführt werden.
Mindestlohn begründet eigenen Beitragsanspruch
Dass bereits Beiträge auf die Sachleistung gezahlt wurden, stehe der Nachforderung nicht entgegen. "Der eigenständige Anspruch auf Mindestlohn begründet einen eigenen Anspruch der Sozialversicherungsträger auf den Gesamtsozialversicherungsbeitrag" so das BSG in seiner Entscheidung.
Sollte die vereinbarte Vergütung durch die Firmenwagennutzung insgesamt überschritten werden, sei dies gegebenenfalls zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer rückabzuwickeln. Dies mache die Nachforderung der Rentenversicherung jedoch nicht rechtswidrig.
(BSG / STB Web)
Artikel vom: 18.11.2025
14.11.25 | Keine erweiterte Grundstückskürzung bei Oldtimern im Anlagevermögen
Die sogenannte erweiterte Grundstückskürzung bietet einen erheblichen Vorteil für Grundstücksunternehmen und ist in der Praxis von entsprechend großer Bedeutung. Ihre Voraussetzungen werden allerdings streng geprüft, so auch in einem Streitfall vor dem Bundesfinanzhof (BFH).
Bei der erweiterten Grundstückskürzung wird der Gewerbeertrag als Besteuerungsgrundlage um den Teil gekürzt, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt. Erlaubt sind dem Grundstücksunternehmen neben der Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes auch eng definierte Nebentätigkeiten. Im Streitfall ging es um eine GmbH, die neben Grundstücken auch Oldtimer im Anlagevermögen hielt, die sie als Wertanlage mit Gewinnerzielungsabsicht angeschafft hatte. Einnahmen wurden damit bislang keine erzielt.
Entscheidung des BFH
Der BFH entschied mit Urteil vom 24.07.2025 (Az. III R 23/23): Schon das Halten der Oldtimer stellt eine gesetzlich nicht ausdrücklich erlaubte Nebentätigkeit dar und führt zur Versagung der erweiterten Grundstückskürzung. Unerheblich sei dabei, dass die Tätigkeit unentgeltlich erfolgte. Eine Unterscheidung zwischen entgeltlichen und unentgeltlichen Tätigkeiten lasse sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen. Nur die Rechtsfolge knüpfe an eine Entgeltlichkeit an, nicht jedoch der Tatbestand.
Zweck der Regelung
Der BFH betonte zudem den Zweck der Regelung: Die erweiterte Grundstückskürzung soll nur solchen Unternehmen zugutekommen, deren Tätigkeit nicht über den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung hinausgeht. Schon geringfügige, nicht ausdrücklich zugelassene Tätigkeiten können daher schädlich sein. Hintergrund der Regelung ist die Gleichbehandlung mit der privaten Vermietung und Verpachtung, die nicht der Gewerbesteuer unterliegt.
(BFH / STB Web)
Artikel vom: 14.11.2025
10.11.25 | Globale Mindeststeuer: EU-Unternehmen im Nachteil durch ungleiche Umsetzung
Die Einführung der globalen Mindeststeuer ("Pillar Two") nach dem OECD-Modell benachteiligt europäische Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Hauptgrund ist demnach die fehlende internationale Abstimmung.
Die gemeinsame Untersuchung des ZEW Mannheim und der Tax Foundation quantifiziert erstmals die Verwaltungskosten der neuen Regeln: Für multinationale Konzerne mit Sitz in der EU entstehen einmalige Implementierungskosten von bis zu zwei Milliarden Euro sowie jährliche Folgekosten von bis zu 865 Millionen Euro.
Besonders betroffen sind große Unternehmensgruppen, die in mehreren EU-Ländern tätig sind. Da andere große Volkswirtschaften die Reform voraussichtlich nicht übernehmen, drohen zusätzliche Standortnachteile für Europa. "Wenn von manchen Volkswirtschaften die Umsetzung von Pillar Two verzögert wird oder gar nicht erst stattfindet, dann funktioniert das System nicht wie ursprünglich beabsichtigt", sagt ZEW-Wissenschaftler Johannes Gaul.
Ungleiche internationale Umsetzung
Während die EU und einige weitere Staaten die Regeln bereits umgesetzt haben, zögern etwa die USA, China und Indien. Dadurch tragen europäische Unternehmen die zusätzlichen Verwaltungskosten, während ihre Konkurrenten in anderen Märkten weiterhin von einfacheren Vorgaben profitieren. Dies verstärke Wettbewerbsverzerrungen und könne Investitionsentscheidungen beeinflussen – bis hin zu Standortverlagerungen. Die Forschenden empfehlen daher eine stärkere internationale Koordinierung.
Hoher Aufwand aufgrund komplexer Regelungen
Hinzu kommt ein erheblicher administrativer Aufwand: Unternehmen müssen zusätzliche Daten erheben und auswerten, etwa zu Abweichungen zwischen handels- und steuerrechtlicher Bilanzierung, Verlustvorträgen und effektiven Steuersätzen pro Land. Viele Konzerne müssen dafür ihre IT-Systeme anpassen und interne Prozesse neu strukturieren.
(ZEW / STB Web)
Artikel vom: 10.11.2025
04.11.25 | Probezeit im befristeten Arbeitsverhältnis
Die Probezeit in einem befristeten Arbeitsverhältnis muss im Verhältnis zur Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen. Einen festen Richtwert gibt es dafür jedoch nicht. Das hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt. Maßgeblich ist stets die Abwägung im Einzelfall.
Eine Arbeitnehmerin war für ein Jahr befristet im Kundenservice beschäftigt. Die Parteien vereinbarten eine viermonatige Probezeit mit zweiwöchiger Kündigungsfrist. Kurz vor Ablauf der Probezeit kündigte die Arbeitgeberin. Die Arbeitnehmerin hielt die Probezeit für zu lang und damit unwirksam – mit der Folge, dass die Kündigung später hätte wirken müssen und der sozialen Rechtfertigung bedurft hätte.
Kein Regelwert von 25 Prozent
Das Landesarbeitsgericht folgte dieser Argumentation teilweise: Als Orientierung für die Probezeit könne man von einem "Regelwert" von 25 Prozent der Vertragslaufzeit ausgehen, im konkreten Fall also maximal drei Monate. Die Kündigung sei zwar grundsätzlich wirksam, ende aber erst später, nach der gesetzlichen Frist.
Lange Einarbeitungszeit rechtfertigt längere Probezeit
Das Bundesarbeitsgericht hat demgegenüber mit Urteil vom 30. Oktober 2025 (Az. 2 AZR 160/24) entschieden, dass es einen solchen Regelwert von 25 Prozent nicht gebe. Entscheidend seien vielmehr die konkreten Umstände des Einzelfalls. Im vorliegenden Fall hielt das Gericht die viermonatige Probezeit angesichts eines detaillierten, 16-wöchigen Einarbeitungskonzepts für verhältnismäßig.
(BAG / STB Web)
Artikel vom: 04.11.2025
28.10.25 | Gehalt: Paarvergleich genügt für Diskriminierungsvermutung
Männer und Frauen haben bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Anspruch auf gleiches Entgelt. Bei einer Klage genügt der hinreichend dargelegte Vergleich mit einer Person des anderen Geschlechts, um die Vermutung einer Entgeltbenachteiligung zu begründen. Der Arbeitgeber muss diese widerlegen.
Dies hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 23. Oktober 2025 (Az. 8 AZR 300/24) klargestellt. Eine Arbeitnehmerin begehrte von ihrem Arbeitgeber hinsichtlich mehrerer Entgeltbestandteile rückwirkend die finanzielle Gleichstellung mit bestimmten männlichen Vergleichspersonen. Sie stützte sich dabei auf Angaben in einem betriebsinternen Dashboard.
Das Landesarbeitsgericht hatte die Klage abgewiesen. Die Klägerin könne sich für die Vermutung einer Entgeltbenachteiligung nicht auf eine einzige Vergleichsperson des anderen Geschlechts berufen. Angesichts der Größe der männlichen Vergleichsgruppe und der Medianentgelte beider vergleichbarer Geschlechtergruppen bestehe keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine geschlechtsbedingte Benachteiligung.
Keine "überwiegende Wahrscheinlichkeit" nachzuweisen
Dem ist das Bundesarbeitsgericht entgegengetreten und stellte nun klar, dass es bei einer Entgeltgleichheitsklage keiner überwiegenden Wahrscheinlichkeit für eine geschlechtsbedingte Benachteiligung bedarf. Dies wäre auch mit Unionsrechts unvereinbar. Für die Vermutung einer Entgeltbenachteiligung genüge es vielmehr, wenn die klagende Arbeitnehmerin hinreichend darlege, dass ihr Arbeitgeber einem anderen Kollegen, der gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichtet, ein höheres Entgelt zahlt (Paarvergleich).
Das Verfahren wurde an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen, das nun prüfen muss, ob der Arbeitgeber diese Vermutung widerlegt hat.
(BAG / STB Web)
Artikel vom: 28.10.2025
21.10.25 | 325.000 Arbeitskräfte zur Bewältigung von Bürokratie
14 Prozent der Betriebe in Deutschland bewerten ihre bürokratische Belastung im Jahr 2025 als sehr hoch. 2022 lag dieser Wert noch bei 4 Prozent. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Den Ergebnissen zufolge hat jeder zehnte Betrieb in den letzten drei Jahren zudem mehr Personal eingestellt, um gesetzliche Vorgaben und Dokumentationspflichten zu erfüllen. Das sind 325.000 zusätzlich eingestellte Personen, so das IAB.
Bei den Großbetrieben mit mindestens 250 Beschäftigten und den mittelgroßen Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten gaben jeweils 30 Prozent an, seit 2022 zusätzliches Personal für Verwaltungsaufgaben rekrutiert zu haben. Bei den Betrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten waren es 16 Prozent und sogar 7 Prozent der Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten haben mehr Personal eingestellt, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Produktivitätsverluste als Folge
"Der Beschäftigungszuwachs zur Bewältigung der gestiegenen Bürokratie umfasst nur einen Teil der zusätzlichen Kosten, die von den Unternehmen getragen werden müssen", sagt IAB-Forscher André Diegmann. Insgesamt würden 80 Prozent der Betriebe höhere Kosten als Folge von gestiegener Bürokratie beklagen. Dies schlage sich zum Teil in einem Verlust der Produktivität nieder, wie 55 Prozent der Betriebe berichten. Weitere 19 Prozent der Betriebe gaben Wettbewerbsnachteile an und 16 Prozent, insbesondere Großbetriebe, sehen in den gestiegenen Aufwendungen auch eine Hürde für Innovationen.
DSGVO ist häufigste Belastung
Zwei Drittel der Betriebe nennen die Datenschutzgrundverordnung als häufigste bürokratische Belastung. Mit deutlichem Abstand folgen die EU-Verordnungen zur IT-Sicherheit mit 32 Prozent sowie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz mit 14 Prozent.
Die Studie basiert auf einer regelmäßigen Betriebsbefragung. Im ersten Quartal 2025 haben über 9.000 Betriebe Angaben zu ihrer bürokratischen Belastung gemacht.
(IAB / STB Web)
Artikel vom: 21.10.2025
19.10.25 | Steuerbefreiung für Elektroautos wird verlängert
Das Bundeskabinett hat am 15. Oktober einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem die Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis 2035 umgesetzt werden soll. Diese hatten die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag vereinbart.
Mit der Neuregelung werden Neuzulassungen oder Umrüstungen bis Ende 2030 (bisher: Ende 2025) befreit. Die zehnjährige Steuerbefreiung gilt bis Ende 2035 (bisher: Ende 2030). Die Befreiung von der Kfz-Steuer soll Kaufanreize für Elektroautos setzen und damit die Automobilindustrie stärken. Gleichzeitig soll die Elektromobilität als Schlüsseltechnologie weiter vorangebracht werden.
Förderung der E-Mobilität
Zuvor hat die Bundesregierung bereits Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität beschlossen: So wurde im Koalitionsausschuss am 8. Oktober ein Förderprogramm vereinbart, um den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität, insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen, zu fördern. Dafür werden bis 2029 die Mittel des EU-Klimasozialfonds zuzüglich 3 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zur Verfügung gestellt.
Weitere steuerliche Anreize
Des Weiteren wurde im Rahmen des sogenannten Wachstumsboosters für Elektrofahrzeuge eine degressive Abschreibung in Höhe von 75 Prozent der Investitionskosten im ersten Jahr eingeführt. Bei E-Fahrzeugen erhöht sich die Bemessungsgrundlage beim Bruttolistenpreis von 70.000 Euro auf 100.000 Euro. Beide Maßnahmen sollten kurzfristig steuerliche Anreize für die Stärkung der Elektromobilität setzen.
(BMF / STB Web)
Artikel vom: 19.10.2025
18.10.25 | Viele Unternehmen bieten Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter
Die von der Bundesregierung geplante Aktivrente soll Anreize für längere Erwerbstätigkeit von Angestellten schaffen und so den Fachkräftemangel mildern. Einer Befragung zufolge bietet jedes dritte Unternehmen kleine oder mittlere Unternehmen (KMU) die Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeiter.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des zunehmenden Arbeitskräftemangels gewinnt die Bindung älterer Beschäftigter an den Arbeitsmarkt an Bedeutung. Eine Sonderbefragung des KfW-Mittelstandspanels im September zeigt, dass rund ein Drittel (32,4 Prozent) der KMU in Deutschland grundsätzlich eine Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern nach Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters ermöglicht.
Unterschiede nach Unternehmensgröße und Branche
Der Anteil variiert allerdings stark nach Unternehmensgröße und Branche: Während 71 Prozent der Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten entsprechende Angebote machen, sind es bei Kleinstbetrieben mit weniger als fünf Beschäftigten nur 26 Prozent. Branchenbedingt bieten vor allem Betriebe im verarbeitenden Gewerbe häufiger Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten an als etwa im Baugewerbe.
Die Erwerbstätigkeit älterer Menschen in Deutschland hat in den Jahren deutlich zugenommen. So stieg die Erwerbstätigenquote der 65- bis 69-Jährigen von 14 Prozent im Jahr 2014 auf 21 Prozent im Jahr 2024 – ein Wert, der über dem EU-Durchschnitt liegt. Hauptursache ist die stufenweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre.
Demografischer Wandel verstärkt Fachkräftemangel
Dennoch werde der demografische Wandel die Erwerbsbevölkerung bis 2035 voraussichtlich um rund 9,4 Prozent schrumpfen lassen, während die Zahl älterer Menschen deutlich wachse, so die KfW. Dies würde den Fachkräftemangel weiter verschärfen, der bereits heute etwa jedes dritte Unternehmen in seiner Geschäftstätigkeit beeinträchtige.
"Die Aktivrente kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie zusätzliche Anreize schafft und damit dem Fachkräftemangel entgegenwirkt", sagt Kathrin Schmidt, Autorin der Studie bei KfW Research. "Insbesondere kleinere Unternehmen zeigen Potenzial, ihre Angebote auszubauen."(KfW / STB Web)
Artikel vom: 18.10.2025
13.10.25 | Firmeninsolvenzen weiter auf hohem Niveau
Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist im September erneut gestiegen. Das berichtete das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Auch das Statistische Bundesamt verzeichnet einen weiteren Anstieg der Insolvenzen.
Konkret liegt die Zahl laut IWH-Insolvenztrend im September bei 1.481. Das seien 5 Prozent mehr als im Vormonat, 14 Prozent mehr als im September 2024 und 64 Prozent mehr als in einem durchschnittlichen September der Jahre 2016 bis 2019, also vor der Corona-Pandemie.
Insgesamt waren im dritten Quartal 2025 4.478 Personen- und Kapitalgesellschaften von einer Insolvenz betroffen. Damit sei der Rekordwert des zweiten Quartals 2025 nur um 1 Prozent unterschritten, so das IWH. Somit wurde im dritten Quartal 2025 die zweithöchste Anzahl insolventer Personen- und Kapitalgesellschaften seit dem dritten Quartal 2005 gemessen – höher als im Nachgang der großen Wirtschafts- und Finanzkrise 2009.
Gesamtwirtschaftliche Probleme und Nachholeffekte
Steffen Müller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung, führt die hohen Insolvenzzahlen auf langanhaltende gesamtwirtschaftliche Probleme sowie auf Nachholeffekte der Niedrigzinspolitik und Corona-Staatshilfen zurück. "Auch wenn im Oktober nochmals hohe Insolvenzzahlen erwartet werden, rechne ich für die kommenden Monate insgesamt mit einer Konsolidierung des Insolvenzgeschehens auf hohem Niveau", sagt Müller. Der Trendanstieg ende, weil die Nachholeffekte an Kraft verlören. Es handle sich um schmerzhafte, aber notwendige Marktbereinigungen sowie Strukturanpassungen, die Raum für zukunftsfähige Unternehmen schaffen könnten.
Auch das Statistische Bundesamt meldet gestiegene Insolvenzzahlen für September. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen sei um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liege in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.
Regelinsolvenzen und Unternehmensinsolvenzen
Regelinsolvenzen sind mit Unternehmensinsolvenzen nicht gleichzusetzen. Sie umfassen neben den im IWH-Insolvenztrend erfassten Personen- und Kapitalgesellschaften auch die Gruppe der Kleinstunternehmen. Zudem werden auch bestimmte natürliche Personen wie Selbstständige oder ehemals selbstständig Tätige mit unüberschaubaren Vermögensverhältnissen sowie privat haftende Gesellschafter und Einzelunternehmer gemeldet.
(IWH Halle / STB Web)
Artikel vom: 13.10.2025

Ihr Ansprechpartner:
Denis Broll
Diplom Ökonom | Steuerberater
Fachberater für int. Steuerrecht
zert. Berater für E-Commerce (IFU / ISM gGmbH)
Telefon: +49 281 / 33 99 33
E-Mail:
Schreiben Sie uns